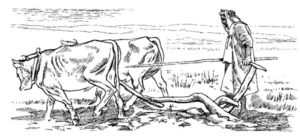Aus irgendeinem Grund fällt mir an dieser Stelle der Spruch ein – alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Je nach Betrachtungsweise kann nämlich jedes der beiden äußeren Stücke sowohl Anfang als auch Ende sein. Eine durchaus dialektische Wurst.
Doch bevor wir uns mit Anfang und Ende befassen, bleiben wir noch einen Moment beim Gleichgewicht der Kräfte. Das Gleichgewicht der wirkenden Kräfte ist Voraussetzung für die dauerhafte Existenz der Strukturen. Die den Strukturen innewohnende Dynamik ist wiederum Ursache für Veränderungen, mit denen auch das Gleichgewicht der Kräfte immer wieder in Frage gestellt wird. Da jede Struktur Bestandteil einer übergeordneten Struktur ist, kann die Veränderung einer Struktur auch Auswirkungen auf die übergeordnete Struktur haben. Natürlich haben auch Veränderungen der übergeordneten Struktur Folgen für die Existenz ihrer Bestandteile. Wenn unsere Sonne eines Tages erlischt, spätestens dann ist auch für die Erde Schicht im Schacht. Unsere Galaxis oder gar das Universum als Ganzes wird davon jedoch kaum berührt werden. Unser Sonnensystem ist eine viel zu kleine Nummer, um im Universum Wellen zu schlagen. Allenfalls ginge ein leichtes Zittern durch den Raum, da sich mit unserem Sonnensystem ein Bestandteil seines Kräfte- und Wirkungsgefüges verabschieden würde, so dass eine Anpassungsreaktion erforderlich wird.
In den riesigen Weiten des Universums vollziehen sich Veränderungen in Struktur oder Bewegung einzelner Teilsysteme praktisch permanent. Daher geht ein ständiges „Zittern“ als Ausdruck der mit ihnen verbundenen Anpassungsprozesse durch dessen Weiten. Dieses Zittern ist, nicht zuletzt wegen der großen Entfernungen, die hier eine Rolle spielen, auf der Erde nur sehr schwach wahrnehmbar, so dass mit heutigen Mitteln eine differenzierende Messung kaum möglich ist. Falls sich jedoch große Veränderungen vollziehen, dann fällt dieses „Zittern“ stärker aus, so dass es unter Umständen gemessen werden kann. Jedenfalls ist über die Messung derartiger Anpassungsprozesse berichtet worden. Der dafür verwendete Begriff der Gravitationswellen ist jedoch problematisch, denn er impliziert eine Ursache, die durch den Doppelcharakter von Welle und Teilchen charakterisiert ist. Doch weder entsprechende Teilchen noch deren Schwingungen, die ja den Wellencharakter begründen müssten, sind nachgewiesen. Fakt ist hingegen, dass Veränderungen im Wirkungsgefüge des Universums gemessen wurden, die aus Veränderungen seiner Struktur resultieren. In den gemessenen Beispielen waren diese Ereignisse eine Fusion von Neutronensternen beziehungsweise eine Vereinigung zweier schwarzer Löcher. Aber nicht nur die Konzentration von Massen sondern auch der umgekehrte Fall, also die Auflösung einer starken Massenkonzentration, sollte einen Anpassungseffekt verursachen, den wir vielleicht irgendwann messen können. Mit der Registrierung dieser Anpassungsprozesse erhalten wir gleichzeitig Nachricht über Veränderungen im Universum.
Eine andere Quelle für Informationen über das Universum ist die Flut der bei uns eintreffenden Photonen und anderer Energiepartikel. Sie wurden irgendwann und irgendwo auf den Weg gebracht und künden nun von ihrem Schicksal. Ohne diese Partikel, die uns permanent erreichen, wüssten wir sehr wenig von dem, was „da draußen“ ist. Dabei sind sie äußerst uneigennützig, denn, treffen sie auf eine Struktur, dann bringen sie nicht nur Informationen mit, sie gehen selbst in dieser neuen Struktur auf. Ihre möglicherweise schon Jahrmillionen andauernde Reise wird abrupt beendet. Dabei kann ihre Reise durchaus abenteuerlich gewesen sein, denn im Weltall lauern überall Gefahren. Es sind zum Beispiel Unmengen von Hindernissen im Weg, die ihnen bei einem Zusammentreffen die Existenz kosten würden. Außerdem lauern da noch „Löcher“, die alles, was in ihren Einzugsbereich gerät, unweigerlich in ihrem schwarzen Schlund verschwinden lassen. Manchmal können die Photonen einer sich abzeichnenden Kollision, zum Beispiel mit einem Stern, jedoch entgehen. Ein Stern, der mit sich und seinen Kräften im Reinen ist und vielleicht sogar Photonen freigebig verschleudert, saugt fremde Photonen nicht in sich hinein. Wenn diese allerdings direkt auf ihn zurasen, dann gibt es auch hier kein Entrinnen, ihre Energie wird absorbiert. Verläuft ihre Flugbahn jedoch in der Nähe des Sterns vorbei, dann kann es zwar trotzdem sein, dass sie in die Reichweite seiner Kräfte eintauchen, sie können aber dank ihrer eigenen Energie und mit Hilfe der vom Stern ausgehenden Fliehkräfte womöglich seiner Schwerkraft entkommen. Nur ihr Flug wird abgelenkt, ihre Flugbahn erhält eine Delle.
Was würde eigentlich passieren, wenn ein rotierendes Zentralgestirn zusätzliche Masse respektive Energie erhielte? Gemeint sind hier nicht die aufschlagenden Photonen, die im Verhältnis zur Masse respektive zur Energie des Sterns einfach zu unbedeutend sind, um größere Wirkungen zu erzielen. Etwas mehr darf es schon sein. Als Folge eines solchen Masse- und Energiezuwachses könnte die Gravitationskraft des Sterns wachsen. Damit er nach einem derartigen Ereignis wieder ins Gleichgewicht kommt, müsste der Stern Fahrt aufnehmen, schneller rotieren, und dem ganzen System auf diese Weise ein höheres Drehmoment verleihen. Aber, wo soll der Impuls dafür herkommen? Wird keine schnellere Rotation initiiert, behält das System jedoch einen Überschuss an Anziehungskraft, so dass womöglich ein schwarzer Moloch entsteht.
Falls die Masse des Sterns abnimmt, zum Beispiel weil er Energie verschwenderisch verteilt, dann muss das ganze System langsamer werden oder die überschüssigen Fliehkräfte werden es irgendwann sprengen. Könnten nicht auch die Trabanten näher an den Kern heranrücken? In einem solchen Fall würde sich das Drehmoment ebenfalls reduzieren. Die Frage wäre allerdings auch hier, wo der Impuls, der die Trabanten näher an den Kern heranrückt, herkommen soll. Trotzdem hat diese Überlegung einen interessanten Nebenaspekt. Nehmen wir einmal an, es wäre möglich, die Trabanten näher an den Mittelpunkt eines rotierenden Systems heranzuziehen, dann müsste das System, gleichbleibende Masse in diesem Fall vorausgesetzt, schneller rotieren, denn die Energie, die im Drehmoment steckt, kann schließlich nicht verloren gehen. Diesen Effekt machen sich Eiskunstläufer zunutze, wenn sie ihre zauberhaften Pirouetten auf das Eis drehen. Sie ziehen die Arme an den Körper und drehen sich schneller um die eigene Achse. Wenn sie die Arme wieder öffnen, werden sie langsamer und können den Lauf fortsetzen.
Was passiert eigentlich, wenn Strukturen ihr Gleichgewicht verlieren? Erst einmal nicht viel. Zeitweise Zustände von Ungleichgewicht sind ebenso selbstverständlich wie solche von Gleichgewicht. Die Betonung liegt auf „zeitweise“, was einschließt, dass das System in der Lage sein muss, ins Gleichgewicht zurückzufinden. Falls die Struktur jedoch einen kritischen Punkt überspringt, kann dies zum Kollaps führen. Die Struktur zerbirst, wenn die Kräfte dauerhaft dominieren, die sie auseinandertreiben, oder sie fällt in sich zusammen, wenn die Sogkräfte das Steuer ansichreißen. In letzterem Fall würde sie nun alles in sich hineinsaugen, was in ihre Nähe gerät. Auf der anderen Seite hatten wir schon gesehen, dass dem Universum offensichtlich ein Mittelpunkt fehlt, der in der Lage wäre, das Ganze zusammenzuhalten. Es bläht sich permanent auf, wobei Strukturen aufgelöst und Masse in Energie verwandelt wird. Das Verfeuern der Masse hat allerdings irgendwann ein Ende, nämlich dann, wenn es nichts mehr zu verfeuern gibt. Und dann?
Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir noch einmal auf den Zusammenhang von Struktur und Bewegung beziehungsweise von Masse und Energie sowie von den aus ihnen resultierenden Kräften zurückkommen. Geklärt hatten wir bereits, dass alle Kräfte aus Bewegungen, das heißt aus Energie erwachsen. Ohne diese Kräfte gäbe es wiederum keine Strukturen, das heißt keine Masse. Gleichzeitig kann freie Energie nur aus Masse entstehen, aus der teilweisen oder völligen Zerstörung von Strukturen. Das eine bedingt das andere. Wenn Kräfte aus Bewegungen innerhalb von Strukturen resultieren, dann heißt das auch, dass dort, wo Bewegungen ersterben, auch die wirkenden Kräfte schwächer werden müssen. Bei extrem niedrigen Temperaturen schwinden die Bewegungen, wodurch die Wirkung der in der Struktur vorhandenen Kräfte abnimmt. Der jeweilige Stoff zeigt in diesem Zustand völlig neue Eigenschaften, Supraleitfähigkeit zum Beispiel. Ähnliches gilt auch, wenn die von außen zugeführte Energie die strukturellen Zusammenhänge auflöst und Plasmazustände entstehen. Für beide Prozesse sind äußere Faktoren ursächlich. Innere Veränderungen können jedoch ebenfalls das Vergehen der Kräfte zur Folge haben. Wenn zum Beispiel die Gravitation übermäßig stark wird, dann kann das dazu führen, dass die Räume innerhalb der Struktur soweit verengt werden, dass Bewegungen kaum mehr möglich sind. Mit den Bewegungen schwinden aber auch die Kräfte. Steht andererseits dem Expansionsdrang der Teile keine ausreichende Kraft entgegen, dann wird dieser irgendwann die Struktur sprengen. Mit der Struktur vergehen wiederum die sie konstituierenden Kräfte.
Und was hat das mit Anfang und Ende des Universums zu tun? Die Vorstellung eines Zustands unendlicher Dichte der Masse als Ausgangspunkt des Urknalls, macht keinen Sinn. Ein solcher Zustand müsste beinhalten, dass jegliche Bewegung erstorben und alle Strukturen zerquetscht waren. In einem solchen Fall wären jedoch auch die im Innern wirkenden Kräfte erloschen. Wo sollte dann die Dynamik des Urknalls hergekommen sein? Wahrscheinlich muss man es sich so vorstellen, dass dem Urknall ein Prozess der Konzentration von Masse vorausgegangen war, der tendenziell zu einem Schwinden der Strukturen und mit ihnen der Bewegungen führte. Dieses Schwinden wurde solange immer wieder hinausgezögert, solange neue Energie respektive Masse herangezogen und einverleibt werden konnte. Als nun ein derartiges Einverleiben von Masse und Energie nicht mehr möglich war, als nichts mehr da war, was einverleibt werden konnte, da wurde ein kritischer Punkt erreicht. Die schier unendlich groß gewordene Gravitationskraft begann zu verlöschen. In dieser extrem verdichteten Masse waren die Strukturen jedoch nicht gleichmäßig vernichtet worden. Hier und da war noch Bewegung möglich, gab es noch Energie, die zur Expansion drängte. Sie war bis dahin von der übermächtigen Gravitationskraft völlig paralysiert worden, bis, ja bis die Gravitationskraft erlosch. Des Korsetts entledigt, steigerte sich die Wirksamkeit der verbliebenen Energie und ihres Expansionsdrangs ins Unermessliche. Sie vermochte es, den Klumpen mit Urgewalt zu sprengen.
Eine neue vielfältige Struktur, ein Universum entstand. Dieses Universum, das aus einer unvorstellbaren Massekonzentration hervorgegangen war, hatte selbst keinen Massemittelpunkt, der es zusammenhalten konnte. Vom Urknall ausgelöst, begann es daher unablässig zu expandieren. Durch die Ausdehnung vergrößerten sich die Abstände der Strukturen voneinander, was wiederum die Wirksamkeit der Kräfte, die die Strukturen aneinander binden, verringerte, so dass sich die Expansion permanent beschleunigte. Die dafür erforderliche Energie wird durch eine Umwandlung beziehungsweise Auflösung von Strukturen freigesetzt. Dieser Prozess erreicht irgendwann ebenfalls einen kritischen Punkt, diesmal einen Punkt äußerst geringer Dichte an Masse. Das, was übrig bleiben wird, ist jedoch kein homogener Brei von ungebundener und damit mehr oder weniger kraftloser Energie. Es wird hier und da Reste von Strukturen geben, deren eigentliche Schwäche im Umfeld allgemeiner Kraftlosigkeit zu großer Stärke erwachsen kann. Jedenfalls werden Kristallisationspunkte entstehen, an denen sich Masse und Energie erneut konzentrieren. Irgendwann wird einer dieser Konzentrationspunkte alle Strukturen des zerfallenden Universums aufgesogen haben und nun selbst eine kritische Dichte erreichen. Voilá – ein neues Spiel kann beginnen.
zuletzt geändert: 22.06.2019